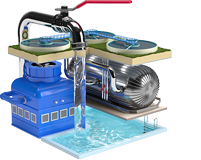Industrien
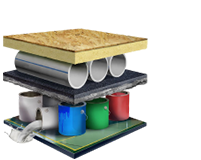
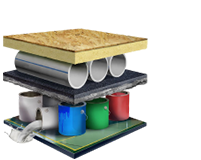
Performance Chemicals
Rohstoffe und Additive, die Prozesse und Produkte sowohl funktionell als auch finanziell optimieren.
Industrien
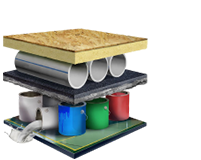
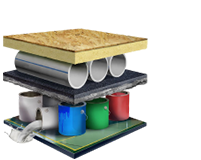
Performance Chemicals
Rohstoffe und Additive, die Prozesse und Produkte sowohl funktionell als auch finanziell optimieren.